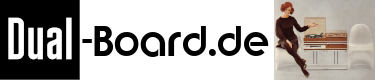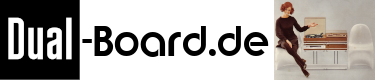Hallo Elektronik- und Röhren-Spezialisten,
ich hab gerade einen V2m-Verstärker aus einem Party 300VX "am überholen" und will dabei auch den Selen-Gleichrichter rausschmeissen und gegen eine 1N4007 austauschen.
Um jetzt keine erhöhte Betriebsspannung zu haben (die Anodenspannung ist mit der 1N4007 an Punkt [C] auf 282 Volt hochgegangen - bei Punkt [D] auf 266 Volt), habe ich experimentiert und einen 390 Ohm/3 Watt Widerstand vor die 1N4007 gesetzt, was dann die Spannung schon ganz gut auf die 252 Volt runtergedrückt hat (Punkt [D] 239 Volt).
Der Widerstand selbst wird nicht sonderlich warm, aber ich möchte gerne berechnen, was er "genau" verbrät.
Ich hab mal die Spannung über dem Widerstand gemessen, aber da ist ja weder reine Wechsel- noch reine Gleichspannung drauf.
Ich messe also von [A] auf [B] eine Gleichspannung von 9,1 Volt (ergibt 0,212 Watt) und/oder eine Wechselspannung von 16,5 Volt (ergibt 0,698 Watt).
Muß ich die jetzt addieren, um die verbratenen Watt zu berechnen - das wären dann zusammen 0,91 Watt (und wenn ich die beiden Voltzahlen vor der Berechnung addiere, wären das 1,68 Watt)?
Was ist nun richtig?
Vom Travo [A] gegen Masse messe ich 10 Volt Gleichspannung
und vom Widerstand [B] gegen Masse messe ich 19 Volt Gleichspannung
Wechselspannungsmessung ergibt bei beiden sehr hohe Spannungen bald bei der Anodenspannung...
Also nochmal 2 Werte, die evtl. für die Berechnung der Verlustleistung des Widerstandes wichtig sein könnten...
Bei meinen Messungen habe ich ausserdem mal das Oszi angeschmissen und damit folgende Ergebnisse bekommen.
- Normalbetrieb mit Selengleichrichter am Travo [A] (gegen Masse) recht sauberer Sinus
An Punkt [C] Sägezahn +-200 mV
- Mit 1N4007 ohne Widerstand am Travo [A] (gegen Masse) oben abgeflachter Sinus (ich vermute, daß das den Gleichspannungsanteil ausmacht)
An Punkt [C] Sägezahn +-300 mV
- Mit 1N4007 UND Widerstand am Travo [A] (gegen Masse) recht sauberer Sinus allerdings an Punkt [B] jetzt der besagte oben abgeflachte Sinus (siehe Bild links).
An Punkt [C] Sägezahn +-150 mV (siehe Bild rechts).
Übrigens ist der (fast) identische Verstärker auch im Party 1007V (dort heißt er V2n).
Dort sind bei gleicher Röhrenbestückung (EF86 und EL95) und nur 3 unwesentlichen Änderungen als Anodenspannung 265 Volt und als Vorstufenspannung 250 Volt angegeben.
So Sorgen wegen hzu hoher Spannungen brauche ich mir also wohl nicht zu machen, obwohl die EL95 mit 250 Volt angegeben ist...
Schöne Grüße,
Andreas