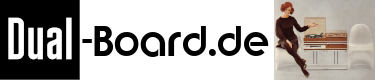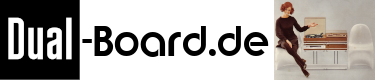Hi !
Das ist ein typisches Symptom für einen falsch eingestellten Tonarmlift.
Der Aufsetzpunkt wird von einem Bolzen auf dem sich mit dem Tonarm drehenden Armsegment untendrunter gegen das hintere Ende der Liftschiene bestimmt. Die Liftschiene wird mit der Drehzahlumschaltung ein Stück vor bzw. zurück geschoben, so daß sich der Zusammenhang: 33 upm / 30 cm und 45 upm / 17 cm ergibt. Bitte auch prüfen, ob die Liftschiene durch die lange Schubstange vom Drehzahlhebel tatsächlich verstellt wird.
Wenn jetzt der Armlift für den Automatikbetrieb zu falsch eingestellt ist, verpassen sich Liftschiene und der Bolzen auf dem Armsegment - er rutscht ggf. ein Stück drunter ... oder verpaßt sie komplett und saust bis zum Abstellpunkt in der Mitte weiter.
Ich würde folgendes Vorgehen anregen:
- Stecker aus der Steckdose
- Drehzahlschalter auf "33" stellen
- die Einstellschraube für den *Handlift* (die silberne Schlitzschraube auf halbem Weg zwischen Tonarmlager und Tonarmstütze) so weit locker drehen, daß sich der Arm mit dem Handlifthebel nicht mehr anheben läßt.
- Teller von Hand drehen und dabei den Steuerhebel auf "Start" ziehen
- weiterdrehen, bis sich der Arm anhebt und beginnt, zum Teller einzuschwenken
- Teller stoppen
- Am Armlager vorne links die gerändelte Stellhülse verdrehen, bis der Arm etwa drei bis vier Millimeter über dem Absatz der Tonarmablage freikommt
- Teller weiterdrehen. Der Arm sollte bei der Einstellung "33" jetzt auf der Position der Einlaufrille zum Halten kommen.
- Weiterdrehen, bis die Automatik zuende gelaufen ist und den Tonarm freigibt. Er sollte nun irgendwo zwischen Tellerrand und Armablage abgesunken sein
- Handlifthebel auf "Heben" stellen
- Einstellschraube für den Handlift so weit andrehen, daß die Nadelspitze ca. 8 mm von der Gummiauflage des Tellers entfernt ist. Dss entspricht einem Hub von rund 6mm bei aufliegender Platte.
- Arm auf die Ablage führen
- Stecker wieder rein und mit "realen Bedingungen" prüfen.
![]()