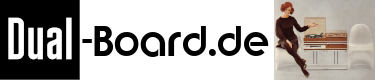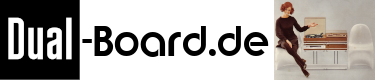schrauber71
Diese Cinch-Stecker von BKL Electronic gefallen mir gar nicht!
1. ist der Innenleiter schief
2. hat die Abschirmhülse nur 1 Schlitz und sitzt eher locker auf einer Cinchbuchse.
Die teureren Metall-Stecker hatte mein Papa mal gekauft, aber die haben einen bösen Wackelkontakt.
Das Fähnchen für die Abschirmung lässt sich am Stecker bewegen, und dieser Übergang ist nun nach Jahren korrodiert!

Mit einem dunkelroten Filzstift habe ich eine Markierung angezeichnet und dann das Massefähnchen weitergedreht.
Mit GIMP habe ich links davon einen roten Pfeil eingezeichnet, damit man das besser sieht.
omue johnny.yen
Das hier ist das Kabel von Goobay®

Der Innenleiter hat Ø 0,35mm, das Abschirmgeflecht ist aus Kupfer mit Alufolie darunter.
Aluminium kann man nicht löten. Das Zell-PE schmilzt auch nicht beim Löten. Ich löte aber höchstens 1,5 sek.
Hier noch zum 1,5 m Goobay®-Cinchkabel für 1,95 € ein Vergleich mit einem 1,5 m langen Cinchkabel für 60 Cent.

Die Kabelkapazität kann man auch ausrechnen: Zylinderkondensator (Wikipedia)
ε Dielektrizitätszahl: PE=2,3 / Zell-PE≈1,6
Ich komme beim Goobay®-Kabel (Zell-PE) auf etwa 50 pF/m und beim Standardkabel (PE) auf etwa 100 pF/m.
50 cm lange Kabel sind leider zu kurz, 1,5 m lange Kabel sind gleich viel zu lang. Also: durchschneiden.
Jetzt fehlt mir nur noch ein gescheiter Stecker zu einem moderaten Preis.