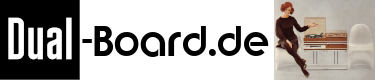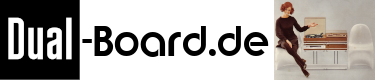Funktionsbeschreibung CS 607 (Halbautomatikversion des 628):
https://www.hifi-archiv.info/Dual/607s/607s-03.jpg
Spannungen werden im Servicemanual nicht genannt.
Beiträge von Passat
-
-
Da stimmt gewaltig etwas nicht.
Ohne Teller dreht der Motor nicht gleichmäßig, sondern dreht hoch, stoppt kurz, dreht wieder hoch etc.
Grund für das Verhalten ist die Art der Regelung.
Die kann den Motor nur beschleunigen, aber nicht abbremsen.
Ohne Teller fehlt das Massenträgheitsmoment des Tellers, so das die Beschleunigung viel zu schnell erfolgt und damit die Regelung aus dem Tritt kommt und o.g. Verhalten zeigt. -
Das hätte man wie Original machen können.
Man braucht dazu nur die passende Folie und einen Schneidplotter.
Der schneidet dann die Buchstaben aus der Folie heraus.Ich habe schon individuelle Aufkleber in einem entsprechenden Shop (gibts in jeder größeren Stadt) machen lassen.
Zu dem Dual-Logo:
Passende Datei erstellen, dann in einen Shop gehen und die Folie plotten lassen.
Schwarz hat jeder Shop vorrätig. -
Hast du denn auch Phono gedrückt?
Tuner und Tape sind für externe Geräte, die an den entsprechenden Anschlüssen angeschlossen sind.Und Mode sollte auf 2ch stehen.
-
Nö,
so geht das nicht. Wie oben beschrieben benötigst Du das Massenträgheitsmoment. Und das Tonarmrohr ist erstmal weniger wichtig - entscheidend sind Headshell und Tonabnehmer.
Und die Entfernung zum Drehpunkt, d.h. bei einem Tonarm zum Lager.
Denn je größer die Entfernung, desto höher ist das Massenträgheitsmoment.
Das kann man sehr gut bei Eiskunstläufern sehen, die Pirouetten drehen:
Breiten die die Arme aus, wird die Drehung deutlich langsamer, legen die die Arme dicht an den Körper an, drehen die schneller.
Da sich bei einem Tonarm das Gegengewicht rel. nahe am Tonarmlager befindet, ist dessen Masse auch deutlich größer als die Summe aus Headshell- und Tonabnehmergewicht.
Und auch beim Plattenteller befindet sich die Hauptmasse am Rand des Plattentellers.
Dadurch ist dessen Massenträgheitsmoment auch höher als wenn man das Gewicht auf den kompletten Plattentellerdurchmesser verteilen würde. -
Ja, der SL-1350 hat ein Kurvenrad.
-
KI ist für die Tonne!
Beispielsweise die KI nach den Bezeichnungen gefragt, die ein bestimmtes Automodell weltweit hatte.
KI liefert 3 Bezeichnungen, richtig sind aber 5 Bezeichnungen.Was DD und Wechsler angeht:
Technics hatte da eine Reihe von Modellen:
SL-1350/1360, SL-1650, SL-1950/1960, SL-3350 und SL-5350. (xx50 = Technics-braun, xx60 = Silber)
Das sind die Wechslerversionen der SL-1300/1310, 1600/1610, 1900, 3300/3310 und 5300/5310.
Beim Design des Technics DD-Motors geht das rel. einfach.
Beim Design der Dual DD-Motoren geht das nur schwer bzw. ist nahezu unmöglich (EDS 5xx).
Das dürfte erklären, warum es von Dual nie einen Wechsler mit DD gab. -
Die neuen Duals bekommen Tonarme mit der Speziallegierung XM 400.

Oder gleich einen ELPJ kaufen.
Da hat man die ganzen Probleme grundsätzlich nicht.
Keine irgendwie gearteten Resonanzen, nicht einmal Nadelverschleiß hat man.
Das Teil tastet das Vinyl nämlich per Laser ab.
Wird gerne von Archiven etc. gekauft, weil die Abtastung der Platte absolut verschleißfrei erfolgt.
Einzige Nachteile:
- reagiert empfindlich auf Schmutz, eine Plattenwaschmaschine ist daher Pflicht
- funktioniert nur vernünftig mit schwarzem Vinyl.
- man kann nicht mit Tonabnehmern, Nadeln etc. experimentieren. -
So ist es.
Beispielsweise wurde damals beim Test des 741Q festgestellt, das die Nadelnachgiebigkeit des TKS 390E weit höher war, als in den technischen Daten vermerkt.
Die haben damals anstatt der Werksangabe 40/30 mm/N satte 63/47 mm/N gemessen.
Damit stimmte auch die Antiresonatoreinstellung nicht.
Anstatt 12 muß man da dann 10 einstellen.
Ohne Meßplatte weiß man davon nichts.Und was die Resonanz angeht:
Welche ist gemeint?
Die Resonanzfrequenz des Systems aus eff. Masse des Tonarms und der Nadelnachgiebigkeit oder die Eigenresonanzen der Komponenten?
Jede Komponente hat nämlich auch selbst eine Resonanzfrequenz.
Komponenten = Nadelträger, Tonabnehmergehäuse, Headshell, Tonarmrohr, Tonarmlagerung, etc.
Bei der ULM2-Serie hat Dual das Tonarmrohr aus der Speziallegierung "XM 300" gemacht, um die Rohrresonanzen zu minimieren.
Oder beim Nadelträger kommen diverse Materialien (Aluminium, Bor, Diamant, Kohlefaser, etc.) und Bauformen (Gerade, konisch, etc.) zum Einsatz, die Einfluss auf die Resonanzen des Nadelträgers haben. -
ADC Accutrac 3500 R, ist von Haus aus voll fernbedienbar und wie ein CD-Player programmierbar.
Das ist ein 6er Wechsler und die Programmierung ist über alle 6 Platten möglich.Und das Ding stammt von 1978!
-
Außerdem sollte man die Typenbezeichnung überdenken. Das soll doch der beste 7er aller Zeiten werden - dann bitte > 750, z. B. CS 764 Q?
Nö.
Bei den aktuellen Duals gibts ein Namensschema:
x18 = manuell/Halbautomat
x29 = Vollautomat
Es gibt 418, 518, 618Q und jetzt 718Q, da der ein Halbautomat ist.
Und 329, 429 und 529.
Diese Nummern wurden bewusst gewählt, weil sie bisher bei den klassischen Duals nicht verwendet wurden.
Und sie setzen das letzte klassische Namensschema fort:
508, 608, 708Q als Halbautomaten
528, 628, 728Q als Vollautomaten
750 und 750-1 folgen schon dem Thomson-Namensschema.
Ein Vollautomat nach aktuellem Namesschema müsste also 729Q heißen.
Oder nach klassichem Namensschema dann als Fortsetzung des alten Namensschemas 751Q. -
Oder einfach einen kleinen Halter bauen und die Empfangdiode am Boden befestigen, so das die zwischen Boden und Aufstellfläche nach vorne schaut.
Die Empfangsdioden haben ja nur ein paar mm an Durchmesser.Dann sieht man die kaum, allerdings ist dann der Empfangswinkel etwas eingeschränkt.
-
Der Empfänger selbst muß nicht von außen sichtbar sein, sondern nur die Empfangsdiode.
Und da gibts welche, die aussehen wie eine LED.
Da könnte man z.B. beim 731Q und 741Q eine der LEDs für die Drehzahlanzeige durch die Empfänger-LED der Fernbedienung ersetzen. -
Genauer: Den SM 100.
Den gabs nur im 1256, 1257 und 1258.505, 506-1, 508, 528, 1264, etc. haben den SM 100-1.
-
Ja.
Das geht sehr einfach:
Einen IR-Empfänger einbauen und die Ausgänge parallel schalten mit den Kontakten der Tasten.
Und schon funktioniert das. -
Genau so müsste man das bei allen Duals mit Tipptasten machen können.
Also z.B. 608Q, 626, 708Q, 714Q, 728Q, 731Q, 741Q.
Und auch 150Q, 610Q, 616Q, 620Q, 630Q, 2225Q und 2235Q.
Und vom 626 gibts sogar eine fernbedienbare Version (nein, nicht der 650 RC), nämlich in Form des Blaupunkt XP-240.
Wobei da der Lift nicht fernbedienbar ist, im Gegensatz zum 650 RC. -
Schau mal hier: RE: High End München - Nachlese
-
- zumal sich zumindest ein Vorteil der dynamischen Balancierung auch durch ein asymmetrisch aufgehängtes Gegengewicht, also eines mit etwas tierferglegtem Schwerpunkt, erreichen ließe (*).
Grüße aus München!
Manfred / lini
*) Womit ich übrigens nicht implizieren will, dass ich persönlich einen höhenverstellbaren Tonarm für so ein besonders wichtiges Feature hielte - aber es gibt halt nicht wenige Phono-Fans, die Wert darauf legen.
Nur bedingt.
Ein kardanische Tonarmlagerung zzgl. dynamische Balancierung macht den Tonarm absolut lageunabhängig, d.h. er ist in alle Richtungen ausbalanciert und würde auch auf die Seite gestellt problemlos spielen.
Das hat Dual ja mit dem Drehgestell seinerzeit auf Messen gezeigt.
Da wurde der Plattenspieler, während er eine Platte abspielt, um alle 3 Achsen gedreht.
Das Drehgestell kann man im Phonomuseum bewundern.Man müsste den Plattenspieler dann nicht mehr zwingend "ins Wasser" stellen.
Theoretisch könnte man ihn auch an die Wand hängen. Man müsste nur den Plattenteller mit Platte fixieren (z.B. mit einer Plattenklemme). -
Das ist klar.
Das gabs ja auch ab Werk so von Dual in Form des CS 608, den es allerdings nur in Nordamerika gab.
Dessen Elektrinik muß man nur nachbauen. -
Beim 496 gibts noch ein Ergänzungsblatt bzgl. eines 496-1.
Der hat den einfachen Tonarm vom 1254 mit TKS Systemaufnahme.
Der 496-1 war mir bisher unbekant.