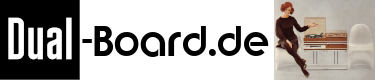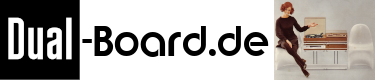Hallo zusammen,
nachdem auch bei mir die Glimmlampe des Stroboskops meines CS721 inzwischen an Altersschwäche verschieden ist, habe ich den Gedanken aufgegriffen, es durch die LED-Version des Dual 608 zu ersetzen. In diesem Zusammenhang kann ich bestätigen, daß es mit dem sog. Pickelteller unverändert übernommen werden kann und in der auf der Webseite
LED Stroboskop für Dual Plattenspieler gut ablesbar (ichwillinsindernet.de)
vorgestellten Version im Zusammenspiel mit dem sog. Pickelteller wie dort beschrieben und aufgebaut auch einwandfrei funktioniert.
Anders sieht es leider bei Verwendung des Sägezahntellers der frühen Version 1 des CS721 aus. Da die LED Lichtpulse im 100 Hz-Rhythmus liefert, ist das Bild des Stroboskops unschön bzw. kaum ablesbar. Abhilfe ist leider nicht so einfach, wie in obigem Link dargestellt: Entfernt man lediglich die Dioden des Vollweggleichrichters (Bild 1), so werden einerseits die Impulse übermäßig breit, und der jeweils 2. Lichtpuls verschwindet nicht, sondern degeneriert zu einem schmalen Nadelimpuls. Dies führt einerseits noch immer zu einem verwaschenen Stroboskopbild und überlastet andererseits die LED, die bereits nach kurzer Zeit durch die entstehende Wärme überhitzen und Schaden nehmen.
Ich habe nun die Schaltung daher wie im Bild 2 modifiziert: Der Kondensator C2 ist im wesentlichen für die Breite des Strompulses durch die LED verantwortlich. Verkleinert man ihn auf nun 2,2µF, erreicht man einen mit rund 500µs sehr schmalen Puls und damit ein sauberes und sehr scharf begrenztes Stroboskopbild. Die Modifikation des Spannungsteilers R1/R2 sorgt dafür, daß der 2. Phantompuls verschwindet. Verwendet habe ich, um trotz der extrem kurzen Pulszeit ein helles Bild zu erhalten, sog. Superhell-LEDs, die inzwischen überall günstig erhältlich sind.
Die Schaltung habe ich mit einem Oszilloskop nachgemessen und die Simulation bestätigt gefunden.
Zum praktischen Ausführung: Für den CS721 ist es notwendig, den Aufbau der Platine sehr flach zu halten, damit sie nicht über den Rand des Plattenspielerchassis hinausragt und an der Zarge anstößt. Die Bauteile sollten daher nicht mehr als 5 mm über die Platinenoberfläche hinausragen; daher bieten sich LED mit 3 mm Durchmesser an. Wer geschickt ist, könnte bzw. sollte den Aufbau deshalb in SMD-Technik vornehmen, die ist jedoch kein Muß. In meinem Fall habe ich konventionelle Bauteile auf Lochrasterplatine verwendet, die 5 mm LED etwas abgefeilt und die Platine mit 7mm Abstandsbolzen in die Chassisgewinde des ehemaligen Stroboskops geschraubt.Den transparenten Kunststoffeinsatz des Stroboskops habe ich mit Tesafilm am Chassis befestigt. Die Schaltung erhält ihre Versorgungsspannung direkt von der Sekundärseite des Trafos bzw. wird an den Lötösen der Versorgungsspannung der Steuerplatine des EDS1000-2 (graue Kabel) abgenommen.
Im Vergleich mit den bekannten, bei Dualfred erhältlichen 1:1 Glimmlampen-Ersatz-LED ist die beschriebene Lösung zwar aufwendig, bietet aber ein helleres und klareres Stroboskopbild (im Bild aufgrund der im Vergleich zum menschlichen Auge „schnelleren“ Kamera ist dieses im angefügten Foto leider nur unvollkommen darstellbar; es ist in der Realität deutlich (!) besser). In der Realität sieht es deutlich besser aus. Der ganze Aufbau ist zudem reversibel und funktioniert auch mit dem Pickelteller der 2. Bauserie.
Grüße, Jürgen